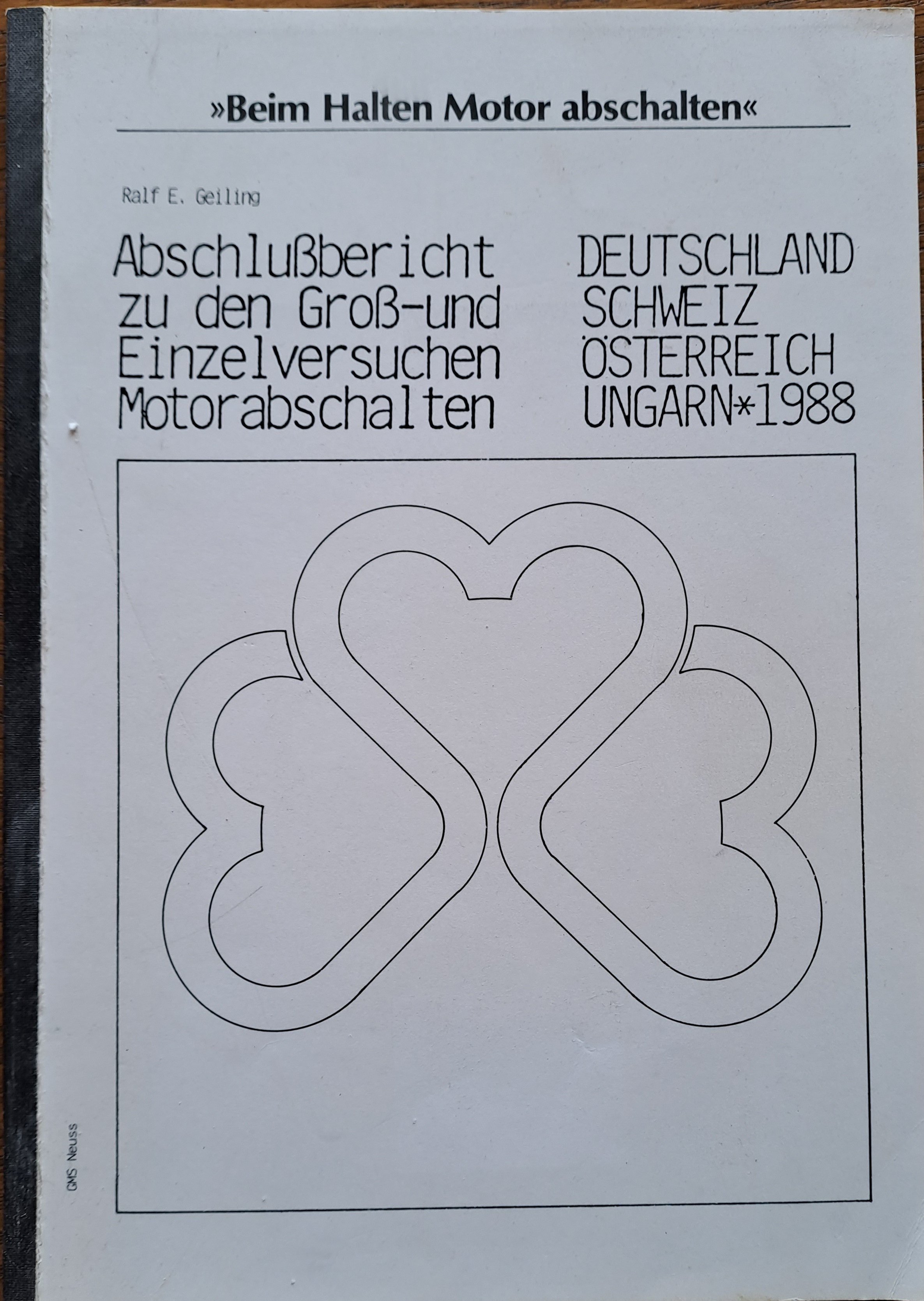
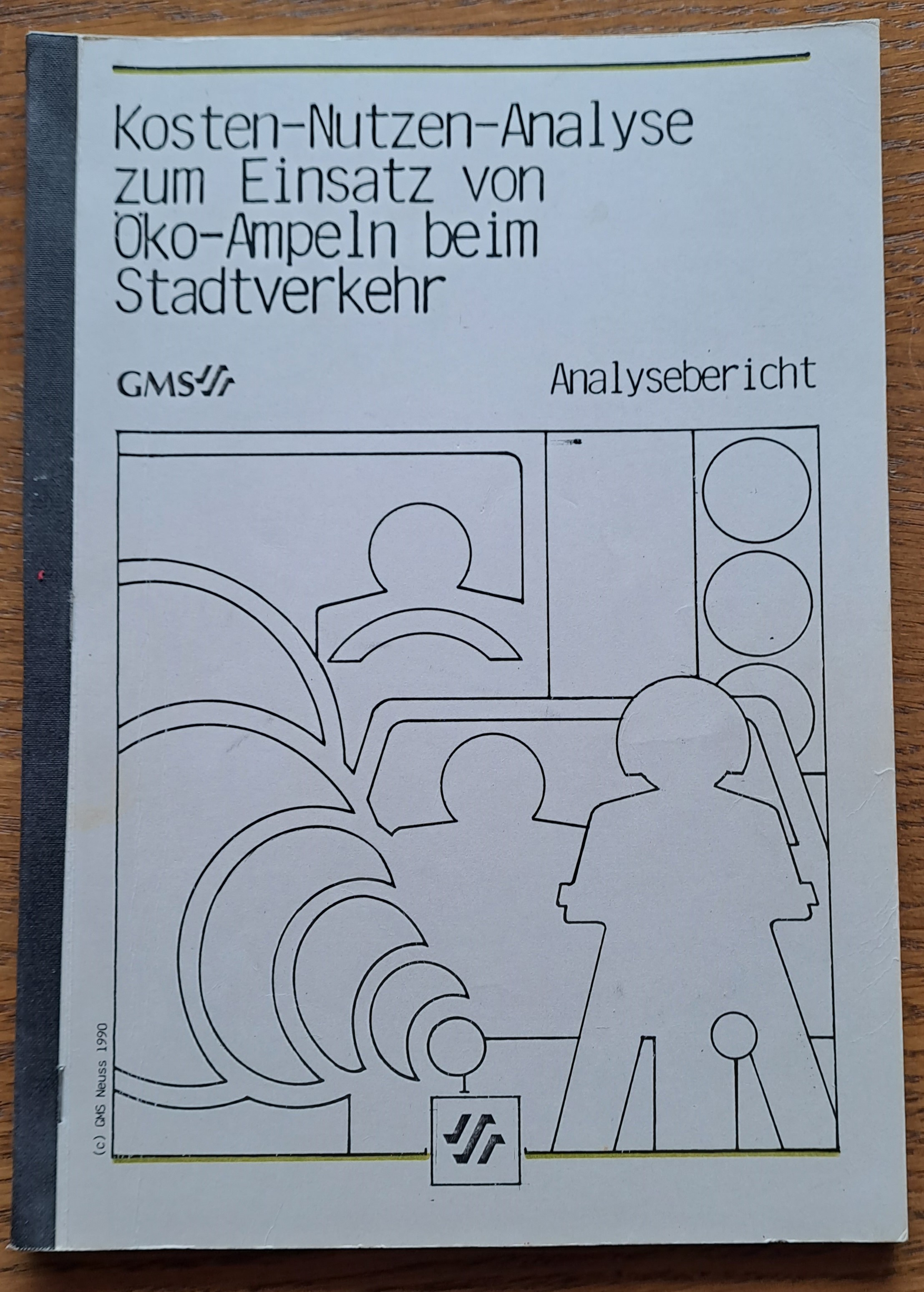
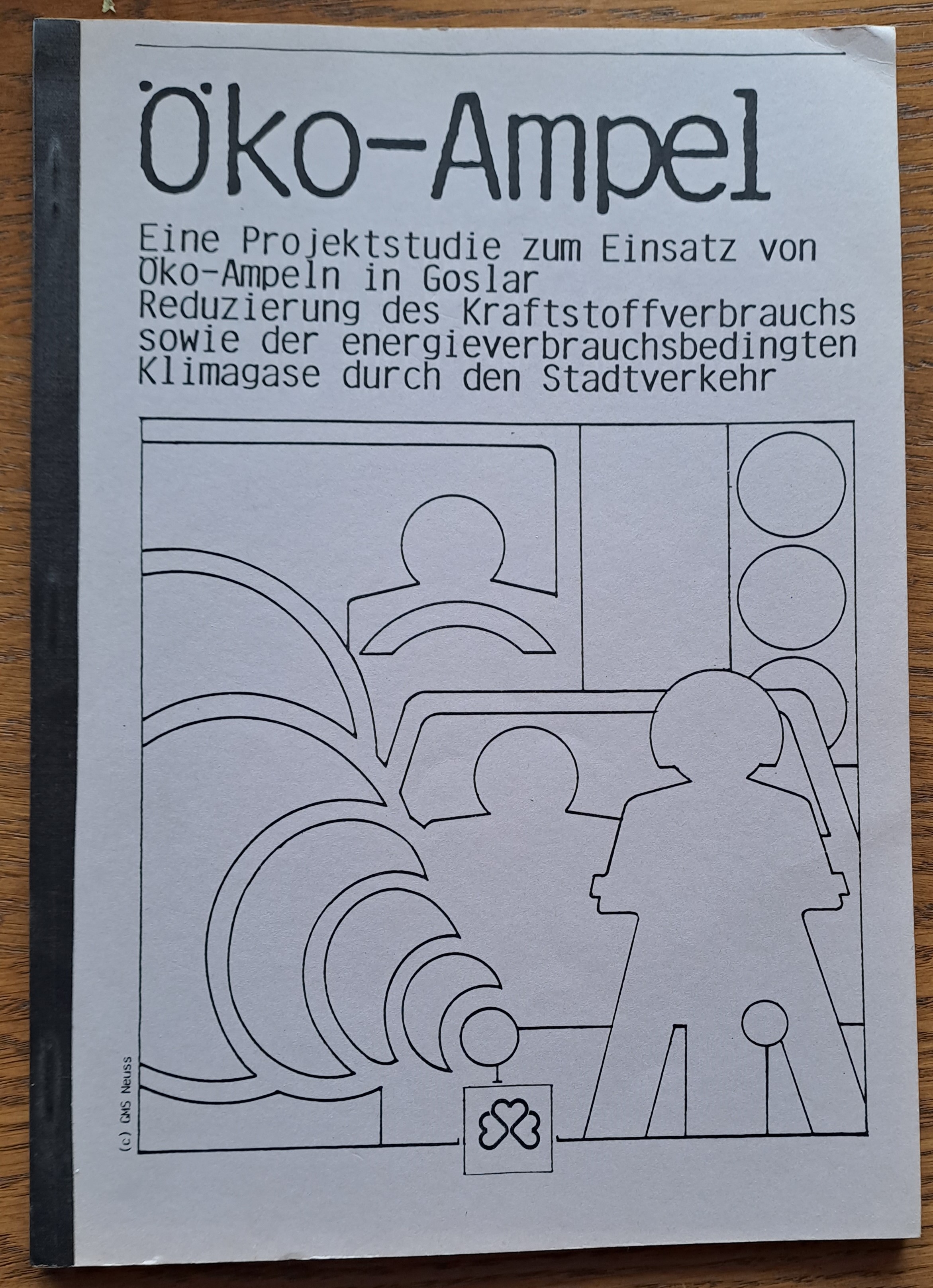
Der Appell "Beim Halten Motor abschalten" fand nicht nur Befürworter. Das führte dazu, dass eine Reihe von Länderministerien, Umwelt- und Verkehrsbehörden entsprechende Studie bei renommierten Instituten für Fahrzeug- und Motorentechnik in Auftrag gaben, und zahlreiche Diplomanten und Doktoranten in- und ausländischer Technischer Hochschulen und Universitäten sich wissenschaftlich mit der Frage beschäftigten, ob, wann und wo das Motor-Abschalten bei verkehrsbedingten Fahrzeugstillstand lohnt, um Kraftstoff zu sparen und um den Ausstoß gesundheits- und umweltschädlicher Motorabgase zu verringern. Kerngedanke war, dass beim Wiederanlassen des Motors zusätzlich Kraftstoff verbrannt und dabei Abgasstoffe ausgestoßen werden. Damals spielte das Thema "Klimagase" noch keine Rolle und nirgendswo wurde erwähnt, geschweige denn erforscht, welchen Einfluss kurzzeitiges Motor-abschalten auf die Reduzierung bzw. den Ausstoß von CO2 hat.
Heute wissen wir, dass der Anteil an Klimagasen (CO2) im Motorabgas bei etwa 99 Prozent liegt. Die übrigen Abgasstoffe, wie das Kohlenmonoxid (CO), die unverbrannten Kohlenwasserstoffe (HC), die Schadstoffe innerhalb der Gruppe der Stickoxide (NOx) und die Partikel insgesamt machen etwa ein Prozent der Abgasgifte aus.
Außerdem werden durch den Abgaskatalysator nicht CO2-Bestandteile im Abgas durch Hinzufügen von Luftsauerstoff in CO2 umgewandelt. Solche Erkenntnisse waren damals selbst den "Experten" in der obersten deutschen Umweltbehörde, dem Umweltbundesamt (UBA), in den zahlreichen Forschungsinstituten, den technischen überwachungsvereinen und den Automobilclubs nicht bekannt. Den Automobilbauern kam das gerade Recht. Ihre Lösung hieß "Abgaskatalysator". Leider kann ein Abgaskatalysator weder den Kraftstoffverbrauch reduzieren noch den Ausstoß von Klimagasen verhindern. Im Gegenteil!
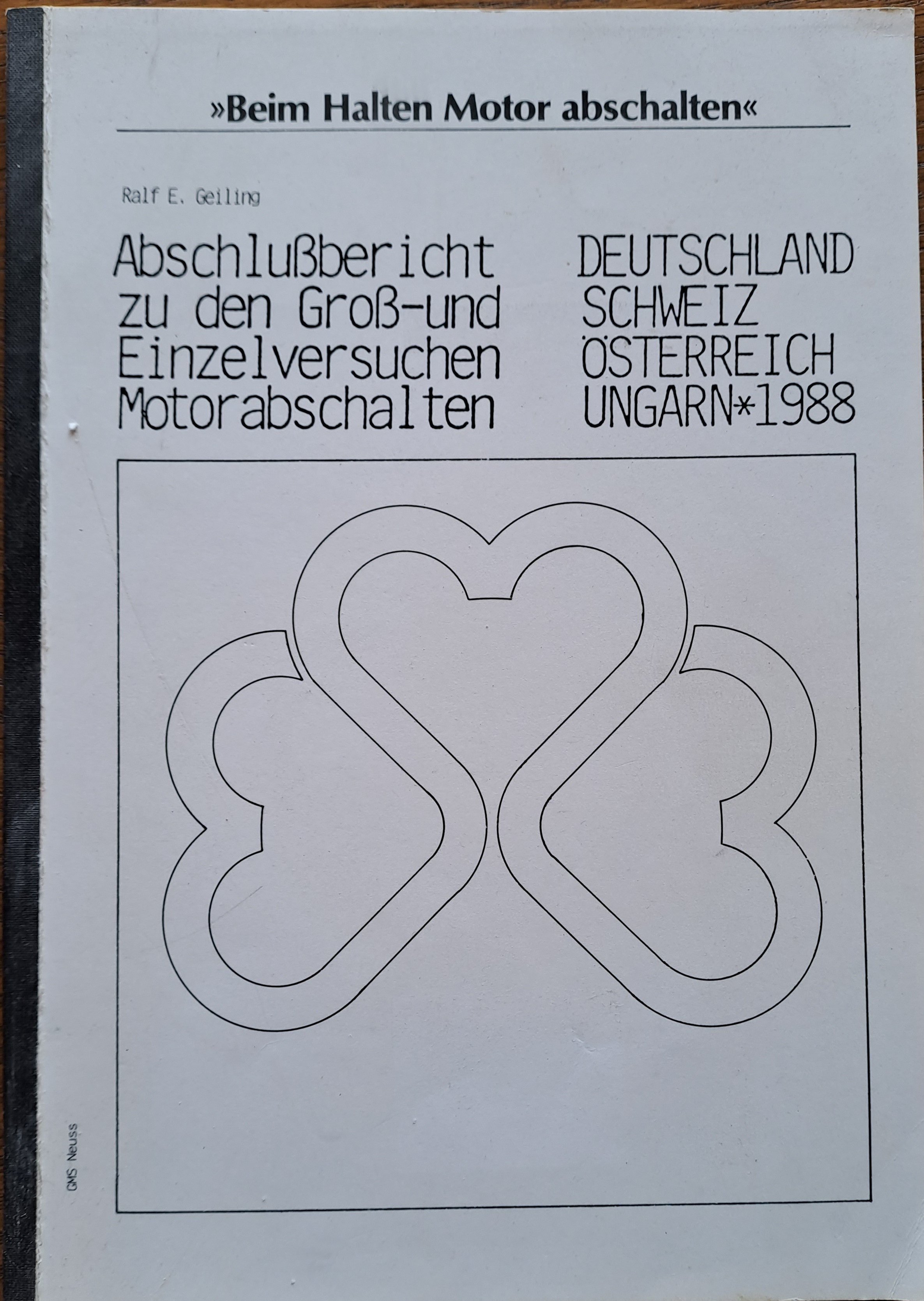
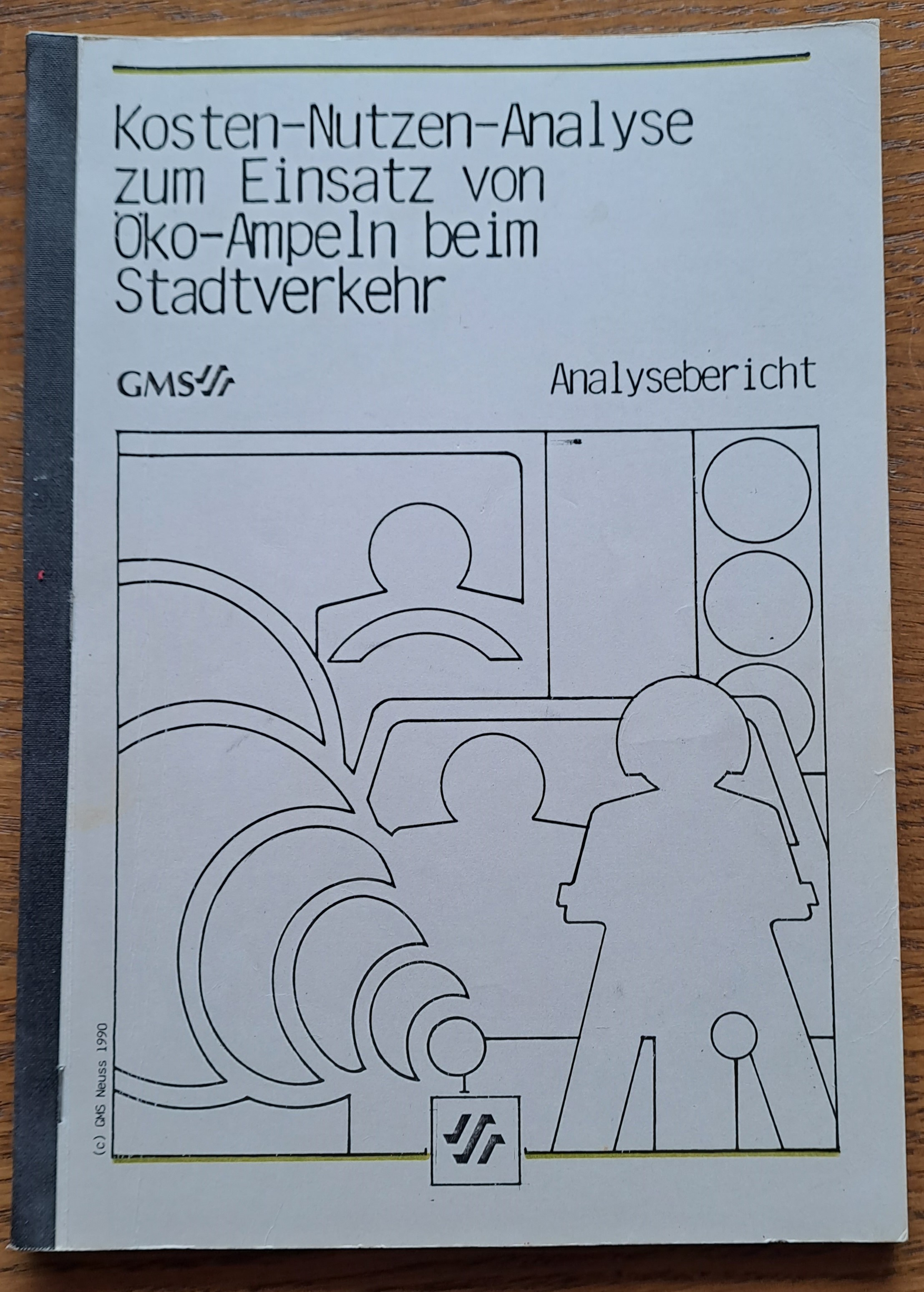
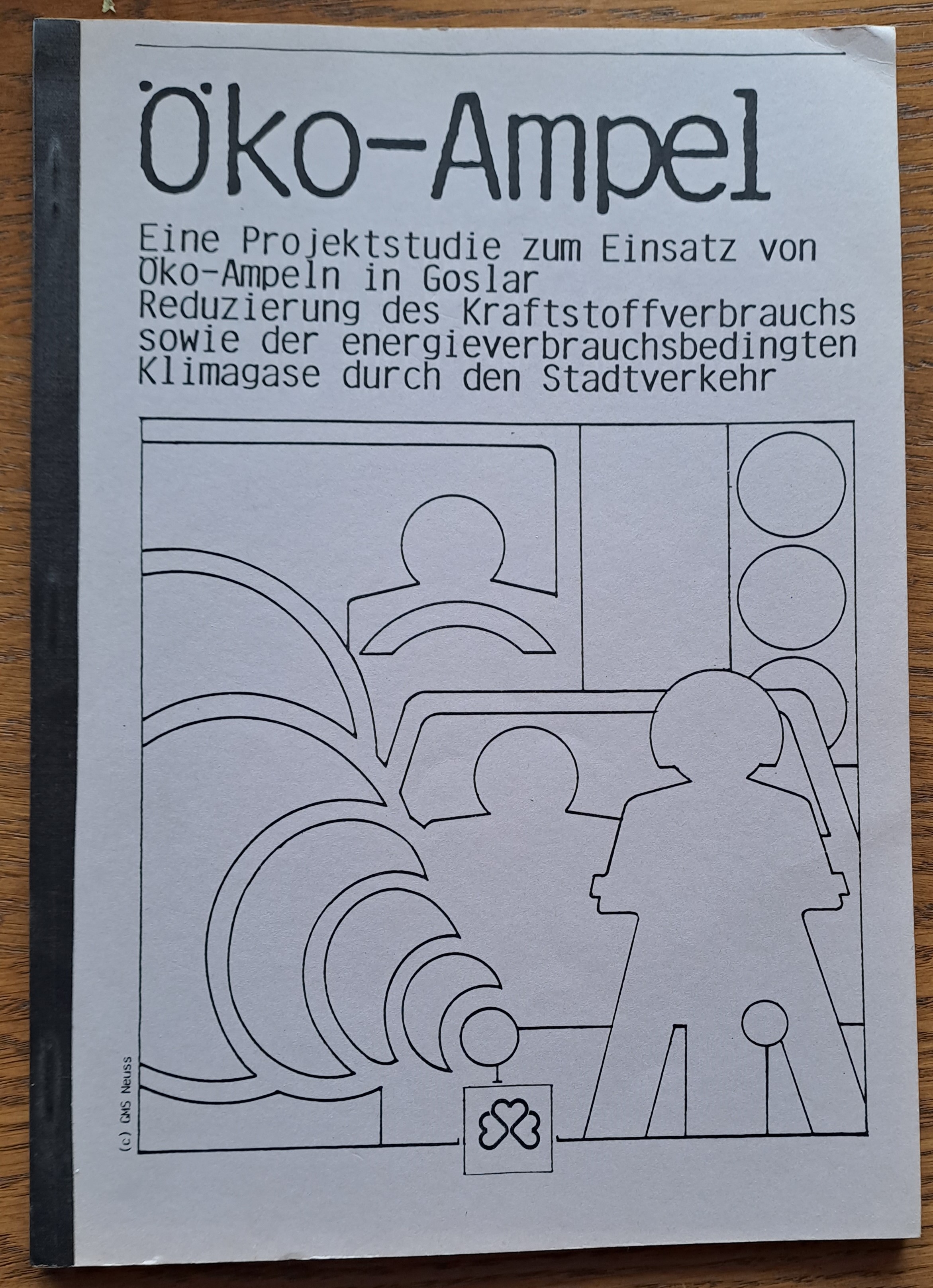
Abschlußberichte zu den Groß- und Einzelversuchen
Seit vielen Jahren werden die urheberrechtlich geschützten Schilder von Schilderprofis wie von Amateuren nachgebildet und in den Handel bzw. auf die Straße gebracht. In der Regel können Baubehörden und Unternehmen, die diese Schilder aufstellen, kaum zwischen Original und Fälschung unterscheiden.







Beispiele nachweisbarer Produktfälschungen
-

Nach rund 50 Jahren befinden sich immer noch die alten Motor-abschalten-Schilder vor Bahnschranken, Ampeln mit langer Rotphase, an Bus-Bahnhöfen und in öffentlichen wie gewerblichen Bereichen, wo Fahrzeuge längere Zeit stehen und warten und die Verbrennungsmotoren im Leerlaufbetrieb kostbare Energie verbrauchen und Abgasgift und Klimagas produzieren.
Weil viele Bahnübergänge nicht mehr (nur) durch Bahnschranken geschlossen werden, sondern Lichtsignale das überqueren regeln, mussten - ebenfalls in Privatinitiative - zwei neue, bundesweit einheitliche Sonderschilder geschaffen werden. Auch diese neuen Schilder sind urheberrechtlich gegen Nachbildung geschützt und dürfen nur von autorisierten Schilderherstellern produziert, angeboten und verkauft werden.
Die Fertigung und Verbreitung von illegalen Kopien, Nachahmungen und Plagiaten sind in Zeiten eines immer härter werdenden Wettbewerbs eine zunehmende Herausforderung für Produzenten, Handel, Auftraggeber/Kunden und Verbraucher.
Verstöße gegen Schutzrechte können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. In der Regel erhalten die Täter eine teure Abmahnung, sind zu Schadenersatz verpflichtet und müssen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Strafanzeige.
Gemäß dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gilt: Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Darüber hinaus ist ebenfalls eine gesamtschuldnerische Haftung nach §§ 830, 840 I, 421 ff. BGB möglich. In der Regel besteht die Gefahr einer zivilrechtlichen Haftung - auch bei Fahrlässigkeit ("hätte wissen müssen"). Im Außenverhältnis kommt dabei grundsätzlich eine Haftung bei dem Verletzer (Hersteller wie Auftraggeber) in Frage, auch wenn vorgetragen wird, in "gutem Glaube" gehandelt zu haben.
Dr. Lukas Breitwieser, Kurator des Deutschen Museums, bezeichnet dieses Schild heute, nachdem es vor 50 Jahren geschaffen und erstmals als Verkehrszeichen aufgestellt wurde, als "Kulturgut".
1985 wurden die ersten Motor-abschalten-Schilder vor dem Bahnübergang in Grevenbroich durch neue Zeichen ersetzt. So konnte das erste der beiden Schilder dem Museum der Meisterwerke der Naturwissenschaft und Technik, dem Deutschen Museum zu München, als ein Stück deutscher Umwelt- und Verkehrsgeschichte übergeben werden. 2023 fand ein weiteres "Schrankenschild" vom Grevenbroicher Bahnübergang - als ein Dokument deutscher Verkehrs- und Umweltgeschichte (made 1974 in NRW) - eine "würdige Bleibe" in der Sammlung der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf.